 von Hans-Peter » 23. Juni 2010, 20:29
von Hans-Peter » 23. Juni 2010, 20:29
Einer dieser Interniertenlager des russischen Geheimdienstes NKWD war bei Neubrandenburg das Speziallager Nr. 9. Vor 1945 war es Lager für russische Kriegsgefangene. Als russisches Internierungslager bestand es bis zum Januar 1949 unter dem Namen „NKWD-Lager Nr. 9 Fünfeichen“, in dem ungefähr 15.000 Frauen, Männer und Kinder interniert gewesen waren. Sie wurden vom sowjetischen Geheimdienst oft ohne Urteil dort interniert und drakonisch bestraft, obwohl die meisten Häftlinge unschuldig waren. Viele wurden einfach wegen ihrer sozialen Herkunft (Unternehmer oder Akademiker) oder wegen ihrer demokratischen Gesinnung interniert (Mitglieder von SPD, LDP und CDU). 5.169 Männer, Frauen und Jugendliche sind dort ums Leben gekommen aufgrund von Hunger, Seuchen und Krankheiten, welche auf die schlechten Haftbedingungen zurückgingen. In der Zeit von Juli bis September 1948 wurden 5.181 Häftlinge in die Freiheit entlassen. 2.801 Häftlinge wurden jedoch in das Speziallager Nr. 2 in Buchenwald und nach Lager 7 in Sachsenhausen transportiert. Einer der Internierten im russischen NKWD-Speziallager Nr.5 Fünfeichen war Pastor Wilhelm Bartelt:
Tagebuch eines Häftlings über das NKWD-Lager Fünfeichen:
Stimme aus dem Schweigelager
In Neubrandenburg ist ein Häftlingstagebuch aus einem sowjetischen Internierungslager veröffentlicht worden. Der Pastor Wilhelm Bartelt, ein chronischer Pedant, schrieb Tag für Tag, sechs Monate lang, von Eintönigkeit, Krankheit, Hunger und Tod. Rita Lüdtke, Leiterin der AG der heutigen Gedenkstätte Fünfeichen: "Noch nie habe ich etwas Bedrückenderes gelesen"
Von Matthias Wyssuwa
Nur wenige Wörter verliert Pastor Bartelt über die Möglichkeit seines eigenen Todes. Er schreibt über Mitgefangene, die erkranken, hungern, sterben. Er zählt Läuse, Brotstücke und Tote. Er ist ein pedantischer Chronist. Aber nur selten dringt die Angst vor dem eigenen Ende so deutlich durch die handgeschriebenen Zeilen wie am 16. November 1945. „Ich sehr schwach, befürchte Kollaps. Mittags eine Laus im Hemd“, heißt es kurz und brüchig nach Tagen unruhigen Schlafs und Arbeitseinsätzen in Kälte und Regen.
„Bartelt hat sich selten mit seiner eigenen Angst beschäftigt“, sagt Rita Lüdtke. Auf ihrem Schreibtisch im Neubrandenburger Rathaus liegt ein Stapel vergilbter Zettel. „Oft scheint es fast kühl, wenn er vom Elend im Lager schreibt.“ Auch wenn sie spricht, hat sie den kleinen Papierhaufen fest im Blick. „Und doch habe ich noch nie etwas Bedrückenderes gelesen als diese Zettel.“ Es sind die heimlichen Aufzeichnungen eines Lagergefangenen - das Tagebuch von Pastor Wilhelm Bartelt, geschrieben im sowjetischen Internierungslager Fünfeichen bei Neubrandenburg. Bartelt schreibt Tag für Tag, von seiner Verhaftung 1945 bis hinein in den ersten Winter seiner Gefangenschaft. Fast sechs Monate Lageralltag hat er festgehalten - auf allem, was er kriegen konnte: alten Rechnungen, militärischen Dienstanweisungen, Lieferscheinen und Kalenderblättern. Auf Lieferscheinen beschrieb Pastor Bartel sein unmenschliches Dasein im Internierungslager.
Frau Lüdtke leitet die Arbeitsgemeinschaft Fünfeichen. Zum sechzigsten Jahrestag der Lagerschließung hat ihr Verein die Aufzeichnungen gemeinsam mit Historikern aufgearbeitet, die Bleistiftwellen entziffert und jetzt als Buch veröffentlicht. Für sie sind die krakeligen Notizen Pastor Bartelts ein wahrer Schatz: Es ist das einzige bekannte Dokument, das in dieser Dichte und Ausführlichkeit über das Leben in einem sowjetischen Internierungslager im Osten Deutschlands zwischen 1945 und 1949 berichtet.
Im Sommer 1945 - weder die Informationen über den Tod Hitlers noch über die Kapitulation Deutschlands sind in alle Teile des heutigen Mecklenburg-Vorpommerns vorgedrungen - beginnt Bartelt seine Aufzeichnungen. 14. Juli 1945: „Nachmittags beim Bürgermeister gemeldet, alle die im letzten Krieg Soldat gewesen.“ Es ist der Anfang seiner Haftzeit, die er nicht überleben wird. Nach der Meldung wird er von russischen Soldaten festgenommen. Im Tross der Gefangenen wandert Bartelt Wochen durch Mecklenburg von Wismar bis Schwerin. Er übernachtet in alten Gutshäusern und wird in deren Kellern verhört. Alles scheint hektisch, disziplin- und planlos. Immer wieder versuchen Häftlinge zu fliehen. 16. Juli: „Ein Mann brach aus der Reihe, als er Frau und Tochter auf Wagen sah. Durch den Begleitmann bedroht, wollte er flüchten, blieb hängen, erschossen.“ In den Stunden des Wartens und des Eingeschlossenseins sind die Gespräche, von denen Bartelt berichtet, geprägt von Gerüchten und Ahnungslosigkeit. Hitler soll mit einem U-Boot nach Argentinien geflüchtet sein, hört Bartelt. Und „der Engländer“ rücke vor bis nach Mecklenburg. Das könnte die Rettung sein. „Wir wissen immer noch nicht, aus welchem Grund wir hier festgehalten werden und vor allem mit welchem Recht“, schreibt Bartelt am 3. August.
Verdächtige einfach weggesperrt
Nach zwei Monaten erreichen die Gefangenen das Internierungslager Fünfeichen. Es ist eines von insgesamt zehn Speziallagern des sowjetischen Geheimdienstes NKWD auf ostdeutschem Boden. „Formal“, sagt der Historiker Mike Schmeitzner vom Hannah-Arendt-Institut an der Technischen Universität Dresden, „entsprechen die Internierungslager der sowjetischen Besatzer dem Abkommen mit den Alliierten.“ Auch in den westlichen Besatzungszonen wurden Internierungslager eingerichtet. Auf den Konferenzen in Jalta und Potsdam hatten die Alliierten beschlossen, Kriegsverbrecher in Lagern zu sammeln, um ihnen den Prozess zu machen. Die „Entnazifizierung Deutschlands“ war das Ziel. Es gebe aber dramatische Unterschiede zwischen Internierungslagern in der westlichen und der östlichen Besatzungszone, sagt Schmeitzner. „Der sowjetische Geheimdienst war kaum an dem Nachweis individueller Schuld interessiert.“ Die Inhaftierten seien nicht aufgrund ihrer Taten eingesperrt worden, sondern wegen ihrer Funktionen. Ein im April 1945 aus dem Moskauer Politbüro ergangener Befehl zählt die Funktionen auf, die zu „automatischem Arrest“ führten. Die Liste umfasste auch niedrige Funktionärsgrade der NSDAP wie Block- und Zellenleiter, aber auch Gruppenführer der Hitlerjugend oder beim Bund deutscher Mädel.
Da die Funktion und nicht die Tat zählte, sei es im Gegensatz zur westlichen Besatzungszone im Osten weit seltener zu Gerichtsverhandlungen oder Urteilen gekommen. „Die Verdächtigen sollten weggesperrt werden, um das Sicherheitsbedürfnis der Besatzer zu befriedigen“, sagt Schmeitzner. Von insgesamt mehr als 120 000 Menschen, die in sowjetischen Lagern interniert waren, wurde nur einem Fünftel der Prozess gemacht. Bartelt war Mitglied der NSDAP und Soldat an der Ostfront. Ob er in Kriegsverbrechen verwickelt war, ist nicht bekannt.
Der Historiker Tobias Baumann, Russlandfachmann beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag, sieht noch einen weiteren Unterschied zu den Lagern im Westen Deutschlands. „Die sowjetischen Speziallager dienten nur in der erste Phase bis Ende 1945 der Internierung von Personen niederer Ränge aus Partei, Verwaltung und Gesellschaft des NS-Regimes“, sagt Baumann. „Schnell aber füllten sich die Lager mit aktiven und vermeintlichen Gegnern der neuen Herrschaft - mit Demokraten, oppositionellen Journalisten und anderen Nicht-Nazis.“ Während in den westlichen Besatzungszonen die Inhaftierten überprüft, im Zweifelsfalle entlassen und die Lager aufgelöst worden seien, hätten die Lager im Osten noch bis 1950 als „Terrorinstrument zur Sicherung des sowjetischen Herrschaftssystems“ fungiert.
Das Lager Fünfeichen existierte schon, bevor die sowjetische Armee bis Neubrandenburg vorrücken konnte. Von 1939 bis 1945 diente es der Wehrmacht als Kriegsgefangenenlager. Franzosen, Polen und Russen waren in Fünfeichen eingesperrt. Nach Schätzungen sind mindestens 2000 von ihnen in dem Lager umgekommen. Verlässliche Zahlen gibt es nicht. Im Frühjahr 1945 besetzten sowjetische Einheiten das Lager. Noch bevor sie alle Franzosen aus dem Nordlager entlassen hatten, füllten sie das Südlager mit ihren eigenen Gefangenen auf. Kalt und windig sei es am 12. September 1945 gewesen, schreibt Bartelt über den Tag, an dem er im Lager eintrifft. Einen breiten Weg entlang reihen sich längliche Holzbaracken aneinander. Stacheldrahtzaun trennt das Lager von den Feldern der Umgebung. Bartelt kommt in Baracke 8. Mit 20 Mann teilt er sich eine 25 Quadratmeter große Stube. Im ganzen Lager sind zu diesem Zeitpunkt gut 8000 Häftlinge interniert.
Die Eintönigkeit war das schlimmste
Es naht der Winter im Lager und die Tage werden austauschbar. Sie unterscheiden sich nur nach der Dicke der Suppe oder der Anzahl der gefundenen Läuse. Manchmal ein gutes Gespräch, manchmal Durchfall. Die Eintönigkeit sei das schlimmste gewesen, berichten Überlebende. Der Arbeitsdienst im „Holz- oder Lehmkommando“ war oft eine harte, aber willkommene Abwechslung vom Warten in kahlen Hütten. „Ohne Tätigkeit furchtbare Langeweile und Hunger“, schreibt Bartelt. Seine Aufzeichnungen zeugen von Hoffnungslosigkeit, von der Verrohung der Gefangenen und vom Hunger und den katastrophalen hygienischen Bedingungen, denen immer mehr Häftlinge zum Opfer fallen. Bartelt berichtet davon, dass ganze Baracken unter Quarantäne stehen - Verdacht auf Diphtherie oder Typhus. Die Häftlinge raunen sich im Stillen die Zahlen der Toten zu. Aus Dutzenden werden Hunderte.
Die sowjetischen Internierungslager waren nicht als Vernichtungslager geplant. Keiner der bekannten Befehle aus Moskau an die Lagerleitungen im Osten Deutschlands lässt auf eine Vernichtungsabsicht schließen. Von den gut 120.000 Gefangenen der zehn Lager kommen trotzdem bis 1949 mehr als 40.000 um. „Durch katastrophale Haftbedingungen wurde der Tod der Häftlinge hingenommen“, sagt Schmeitzner. Er nennt die Internierungslager „Todeslager“. In Fünfeichen kommen bis zum Herbst 1948 4900 Gefangene ums Leben.
In der DDR verschwand das Lager
Dann wird das Lager geschlossen. Es sei zu sanierungsbedürftig, heißt es in einem sowjetischen Gutachten. Ein Großteil der Häftlinge wird entlassen, ohne Begründung, Verhandlung und Entschädigung. Wohl aber mit der Auflage, über die Lager zu schweigen. Für die anderen ging die Reise durch die Lager weiter - manchmal bis in die sowjetischen Gulags. Das letzte Internierungslager auf ostdeutschem Boden wurde 1950 geschlossen.
Heute säumen bronzene Tafeln mit den Namen der Opfer die Massengräber in Neubrandenburg. Wo Zäune und Wachtürme Menschen einsperrten, wachsen heute schiefe Bäume und Sträucher. Rita Lüdtke geht langsam an den Tafeln entlang und erzählt vom Schweigen und Erinnern. In der DDR verschwand das Lager. Die Baracken wurden abgerissen, das Gelände wurde zu militärischem Sperrgebiet. Es gab Gerüchte, aber kein Gedenken. Das Lager erhielt einen weiteren Spitznamen: „Schweigelager“. Die Drohungen des Regimes seien erfolgreich gewesen, sagt Frau Lüdtke.
„Nicht Schuld oder Unschuld, sondern menschliches Leiden“
Erst nach 1990 kamen Überlebende und erzählten ihre Geschichte. Auch Pastor Bartelts Tagebuch tauchte in dieser Zeit das erste Mal auf. Über viele Umwege gelangte es zu Frau Lüdtkes Verein. Ein Mitgefangener Bartelts hatte die Zettel, eingeschlagen in eine Leinenhülle, im Januar 1946 aus dem Lager schmuggeln und bei einem Außeneinsatz im zerstörten Neubrandenburg Bartelts Frau zustecken können. Von ihr gelangte es zu Bartelts Tochter. Sie versteckte die Aufzeichnungen ihres Vaters über Jahrzehnte, bis sie diese schließlich der Arbeitsgruppe Fünfeichen überließ. Anfang der neunziger Jahre begann die Stadt die Anlage vom Wildwuchs der Zeit zu befreien. An den Stellen, an denen die Massengräber vermutet wurden, ließ sie nach Überresten graben. Am Tag arbeiteten Historiker auf den Lichtungen, in der Nacht kamen Angehörige von Opfern und steckten Holzkreuze in die aufgewühlte Erde.
Heute erinnert ein zentrales Mahnmal an alle Opfer von Fünfeichen - ein großes, gestütztes Kreuz, eine Kirchenglocke, sieben Stelen aus gebrochener Eiche für die sieben Lagerjahre bis 1945 auf der einen Wegseite, vier für die Zeit bis zur Schließung gegenüber. Widerstand dagegen, gemeinsam an einem Ort um alle Toten zu trauern - um die Opfer der Deutschen und um die deutschen Opfer -, habe es nicht gegeben, sagt Frau Lüdtke. „Die Gedenkstätte beantwortet nicht die Frage nach Schuld oder Unschuld, sie erinnert an menschliches Leiden.“ Nur davon berichte auch Bartelts Tagebuch. Frau Lüdtke hat es von der Tochter des Pastors geerbt. Sie ist kurz vor der Veröffentlichung des Buches gestorben. „Bartelts Tochter war überzeugt, dass ihr Vater weiter geschrieben hat“, sagt sie. Nur hätten es diese Zettel nicht mehr aus dem Lager heraus geschafft. Sie sind verlorengegangen oder wurden vernichtet.
Der letzte Tag in Bartelts Tagebuchaufzeichnungen ist ein Donnerstag, der 10. Januar 1946: „Sehr schlecht geschlafen, Hautjucken; außerdem furzte Sachse fortwährend und hustete mir ins Gesicht.“ Im August 1947 stirbt Bartelt im Alter von 59 Jahren.
Text: F.A.Z.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
![Hallo [hallo]](./images/smilies/hallo.gif)









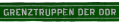
![Rose [rose]](./images/smilies/rose.gif)
![Peinlich [peinlich]](./images/smilies/peinlich.gif)
![Lachen [laugh]](./images/smilies/laugh.gif) und wenn Dir dazu nichts einfällt, trag deine Zeitungen im Muldental aus und weiter nichts,
und wenn Dir dazu nichts einfällt, trag deine Zeitungen im Muldental aus und weiter nichts,