
Eine Studie aus den USA beweist, was viele ahnen. Die Nachkriegsgeneration erlebte einen sagenhaften ökonomischen Aufstieg. Heute steigt die junge Generation dagegen ökonomisch ab.
Die Ahnung, dass die Zeiten dauerhaften Wachstums vorbei sind, beschleicht viele junge Leute. Etwa wenn sie mit befristeten Verträgen und einem bescheidenden Einkommen einen Vertrag mit Staffelmiete unterschreiben. Das Gefühl, dass der Satz "uns ging es noch nie so gut" nicht so ganz zutrifft, wird von mehreren Langzeituntersuchungen bestätigt. Wir berichteten, über eine McKinsey-Studie, die die Einkommensentwicklung in 25 Industriestaaten verfolgte. Das Ergebnis war schockierend: Zwei Drittel müssen mit einem realen Nullwachstum oder einem schrumpfenden Budget zurechtkommen. Der länderübergreifende Megatrend heißt Verarmung.
Die Ahnung, dass die Zeiten dauerhaften Wachstums vorbei sind, beschleicht viele junge Leute. Etwa wenn sie mit befristeten Verträgen und einem bescheidenden Einkommen einen Vertrag mit Staffelmiete unterschreiben. Das Gefühl, dass der Satz "uns ging es noch nie so gut" nicht so ganz zutrifft, wird von mehreren Langzeituntersuchungen bestätigt. Wir berichteten, über eine McKinsey-Studie, die die Einkommensentwicklung in 25 Industriestaaten verfolgte. Das Ergebnis war schockierend: Zwei Drittel müssen mit einem realen Nullwachstum oder einem schrumpfenden Budget zurechtkommen. Der länderübergreifende Megatrend heißt Verarmung.
Wem geht es besser: Den Kindern oder den Eltern?
In den USA – einst das Land der unbegrenzten Möglichkeiten – hat sich die renommierte "New York Times" ("The American Dream, Quantified at Last") einmal angesehen, wie die Entwicklung der Einkommen wirklich verläuft. Runtergebrochen wurde der amerikanische Traum auf die simple Frage: Werden es die Kinder einmal besser haben als die Eltern?"
Denn genau das war die Verheißung der Nachkriegszeit. Vorteil dieses Blickwinkels ist, dass jeweils die Entwicklung in den verschiedenen soziologischen Gruppen betrachtet wird. Steigende Durchschnittswerte allein könnten bedeuten, dass es einzelnen Gruppen sehr viel besser geht – etwa den reichsten zehn Prozent – während sich beim Rest gar nichts zu tut.
Der Nachteil: So eine Forschung ist sehr viel aufwändiger, weil die verfügbaren und aufbereiteten statistischen Daten den Familien-Faktor nicht berücksichtigen. Möglich wurde die Untersuchung nur, weil das Team um den Ökonomen Raj Chetty für die Forschung Zugriff auf Millionen von Steuerakten bekam. Die Untersuchung bezieht sich nur auf die USA, andere Studien legen nahe, dass die Entwicklung in Deutschland ähnlich verläuft.
Die goldene Nachkriegszeit
Ein Kind, das 1940 geboren wurde, hatte demnach eine 92 prozentige Chance, ein besseres Einkommen zu erzielen, als die eigenen Eltern. 8 Prozent gelang das nicht, man musste sich also schon anstrengen, um nicht aufzusteigen. Der Grund ist einfach. Die Wirtschaft wuchs stetig und das Wachstum verteilte sich auf Arme, Reiche und die Mittelschicht.
Aber: Dieses Jahrzehnt war die Ausnahme. Mit jedem Jahrzehnt wurde es schwerer aufzusteigen. Die letzte untersuchte Kohorte wurde 1980 geboren und dürfte jetzt 36 sein. Hier gelingt es nur noch der Hälfte, die eigenen Eltern zu überflügeln. Man könnte jetzt sagen, das sei immer noch ein guter Wert: Der Hälfte geht es ja besser! Das ist aber ein statistisches Missverständnis. Tatsächlich bedeutet diese Zahl Stagnation: Einer Hälfte geht es besser als den Eltern, die anderen halten aber nicht deren Standard, sie sinken ab. Ihnen geht es schlechter. Der allgemeine Fahrstuhl nach oben hielt für die 1980 Geborenen bereits an. Mit guter Ausbildung oder harten Ellbogen gelang eine Hälfte nach oben, die andere nicht.
http://www.stern.de/wirtschaft/news/das ... 33260.html
AZ









![Hallo [hallo]](./images/smilies/hallo.gif)
![Mannoman [flash]](./images/smilies/flash.gif) Wenn Du eins brauchst bekommst Du eins gestellt, musst nicht Dein eigenes nehmen. Zumindest kenne ich das so. Das vermeidet, dass man nach Feierabend von einem Kunden angerufen wird. Ansonsten bin selbst ich Dinosaurier des Informationszeitalters kein Mensch mehr ohne so ein Ding.
Wenn Du eins brauchst bekommst Du eins gestellt, musst nicht Dein eigenes nehmen. Zumindest kenne ich das so. Das vermeidet, dass man nach Feierabend von einem Kunden angerufen wird. Ansonsten bin selbst ich Dinosaurier des Informationszeitalters kein Mensch mehr ohne so ein Ding. ![Traurig [frown]](./images/smilies/frown.gif)
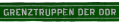
![Lachen [laugh]](./images/smilies/laugh.gif)
![Freude [freu]](./images/smilies/freu.gif)
![Grinsen [grin]](./images/smilies/evilgrins.gif)